
 |
Wahrzeichen der Stadt |
1725 verbesserte sich mit der Gründung des Eisenwerkes Lauchhammer die Lage der Landbevölkerung
 |
Luftbild |
 |
Fachwerkhäuser in Lauchhammer-Ost |
Zu größerer Bedeutung gelangte Lauchhammer gegen 1725, als im heutigen Lauchhammer-Ost Raseneisenstein gefunden und mit der Ausbeutung dieses Natursteins unter der Freifrau von Löwendal begonnen wurde. Die Erzeugnisse aus den hiesigen Hammerhütten waren sehr gefragt und bald entwickelte sich der Name Lauchhammer, der bis heute seine Gültigkeit beibehalten hat. Das Wort Lauch bedeutete im Sprachgebrauch

Kunstguß in Lauchhammer |
Das Lauchhammerwerk begründete seinen Ruf seit 1825 insbesondere durch die Herstellung
diverser Industriemaschinen. Das Eisenwerk fertigte Gießereierzeugnisse, Bronzeguß und
emailliertes Geschirr. Ab 1872 wurde es in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Ab 1884 erfolgte ein
ungeahnter wirtschaftlicher Aufschwung, der auch in den schweren Jahren nach 1918 anhielt. Nach dem
2. Weltkrieg wurde der Betrieb teilweise demontiert und mußte in den Folgejahren wieder aufgebaut
werden. Heute ist die Stadt Lauchhammer teilweise industriell geprägt.
Der Bagger,- Fördertbrücken,- und Gerätebau MAN TAKRAFT GmbH ist als international
tätiges Unternehmen diesem Standort stark verbunden. Wirtschaftsförderung und Qualifizierung haben
hier schon viele Menschen in Arbeit gebracht. Der hohe Anteil gut ausgebildeter Facharbeiter, die
Industrieflächen und Gewerbegebiete bieten günstige Ansiedlungsbedingungen für
Dienstleiser Handwerker und Kleingewerbe.
Die ehemalige Siedlung Dolsthaida wurde nachweislich am 15. September 1798 schriftlich erwähnt. Seit ihrer Gründungszeit gehört sie direkt zum Rittergut Mückenberg. Der Name der Ortschaft entstand durch eine kleine Heide hinter dem Haus eines früheren Einwohners mit Namen "Dolst". Die alte Schreibweise des heute fast 1700 Einwohner zählenden Ortsteils war übrigens "Dolst Heyde". Erst 1906 erhielt die Kolonie den Status einer selbstständigen Gemeinde. Durch die Bildung der Großgemeinde Lauchhammer wurde Dolsthaida 1950 der Stadtteil Lauchhammer-Süd. Die Fertigung von Braunkohlenbriketts machte diesen Stadtteil weit über seine Grenzen hinaus bekannt.
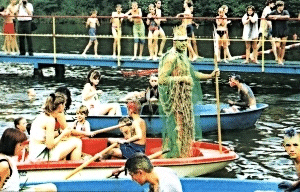 |
Neptunfest im Naturbad Mückenberg |
Die Namensaussprache änderte sich mehrfach. "Mückenberg" weist auf eine Wasserburg hin, da im wendischen Sprachschatz "Mok" soviel wie naß und "berg" von "berga" abgeleitet sein könnte, was in etwa "sich vor dem Feind verbergen" heißen könnte. Der Begriff Mockenburg (zeitweilig auch: Muckenbergk und Muckenberg) stammt aus den Anfängen der örtlichen Geschichtsschreibung. Bis gegen Mitte des 15. Jahrhunderts blieb der Name auch bestehen. Von dieser Zeit an ist die Bezeichnung Mückenberg überliefert.
In Hügelgräbern und anderen Fundstätten wurden Gegenstände aus der Bronzezeit (1400 bis 400 v. Chr.) entdeckt, die auf eine sehr frühe Besiedlung schließen lassen. Wie andere Orte der näheren Umgebung gewann Kleinleipisch erst um 1200 an Bedeutung.
 |
Reiterhof in Kleinleipisch |
Das Siegel der Gemeinde Kleinleipisch trug -ebenso wie das von Mückenberg, Bockwitz und Grünewalde- das Einsiedlersymbol bis zum Rumpf und darunter die Grafenkrone. Rechts und links vom Einsiedler ist eine Kornähre zu finden, welche den überaus fruchtbaren Boden der Kleinleipischer Talmulde symbolisiert.
Grünewalde mit seinen rund 1600 Einwohnern liegt an der Westgrenze des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Urkundlich wird der Ort erstmalig 1418 unter dem Namen "Grunenwalde" erwähnt und ist als "Siedlung im grünen, laubreichen Walde" anzusehen. Die früher gebrauchte slawische Bezeichnung "selendrewo" entspricht dem deutschen Ortsnamen. Im Jahre 1993 entschieden sich die Bewohner des Ortes für ein Zusammengehen mit Lauchhammer. Seitdem ist Grünewalde ein Ortsteil dieser Stadt. In früheren Zeiten war Grünewalde ein Mühlendorf, wovon noch heute die bestehende Dorfmühle Richter zeugt, die ein Mühlenhofmuseum beherbergt. An der Abzweigung zum Sportplatz befindet sich ein Rhododendrenpark mit altem Eichenbestand. Das Naherholungsgebiet "Grünewalder Lauch" ist dem Ortsnamen nachempfunden und durch eine Bürgerinitiative 1978 entstanden. Die Wiedernutzung und der Ausbau eines Tagebaurestloches wurde damals vom Bezirkstag Cottbus beschlossen und durch besagte Bürgerinitiative in Eigenleistung verwirklicht.
 |
Tagebauaussichtspunkt der LAUBAG |
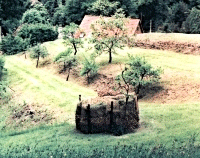 |
Weinberg |