Braunkohlentagebau
Die Geschichte des Lausitzer Braunkohlebergbaus reicht weit
bis in das 18. Jahrhundert zurück. Anfangs erfolgte die
Gewinnung des heimischen Bodenschatzes in kleinen Erdlöchern.
Von der Rasensohle aus, später auch unter Tage. Etwa ab dem Jahr
1850 wurde begonnen, die Braunkohle industriell zu nutzen. Aus
kleinen privaten Gruben, die ausschließlich zur Versorgung mit
Heizmaterial dienten, entwickelte sich im Laufe der Zeit ein
leistungsfähiger Industriezweig auf hohem technischem Niveau. 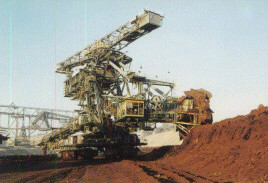 Die Fördermengen, in der Anfangszeit nur einige
hundert Tonnen, stiegen ständig und erreichten fast 200
Millionen t im Jahr 1989. Die Braunkohle war damit eine wichtige
Basis für die Entwicklung der Lausitzer Wirtschaft und des
Wohlstandes der Einwohner. Zugleich prägte der Bergbau Natur und
Umwelt im Revier. Mit der Inanspruchnahme von Flächen für die
Kohleförderung und der nachfolgenden Rekultivierung wurde das
Landschaftsbild der Lausitz entscheidend beeinflußt. Jedoch
konnte die Wiederherstellung der Landschaft nach dem Bergbau in
jedem Falle der Inanspruchnahme standhalten.
Die Fördermengen, in der Anfangszeit nur einige
hundert Tonnen, stiegen ständig und erreichten fast 200
Millionen t im Jahr 1989. Die Braunkohle war damit eine wichtige
Basis für die Entwicklung der Lausitzer Wirtschaft und des
Wohlstandes der Einwohner. Zugleich prägte der Bergbau Natur und
Umwelt im Revier. Mit der Inanspruchnahme von Flächen für die
Kohleförderung und der nachfolgenden Rekultivierung wurde das
Landschaftsbild der Lausitz entscheidend beeinflußt. Jedoch
konnte die Wiederherstellung der Landschaft nach dem Bergbau in
jedem Falle der Inanspruchnahme standhalten.

Um die Jahrhundertwende entstanden in der Lausitz die ersten
begrünten Kippen und Hochhalden blieben meist sich selbst überlassen.
Nach einigen Jahren begrünten sie sich durch Anflug und nach
wenigen Jahrzehnten trugen sie in natürlicher Sukzession
entstandene Wälder. Typisch für die natürliche Bewaldung sind
Kiefer, Birke und Espe, oft auch die "eingebürgerte"
Robinie. Naturschutz und Erholung haben heute einen wichtigen
Platz in der Bergbaufolgelandschaft. Mit der veränderten
Nutzungsstruktur des in Anspruch genommenen Territoriums ergaben
sich nach der bergbaulichen Tätigkeit günstige Bedingungen,
Bereiche für die aktive Erholung der Menschen zu schaffen. Zum
einen erwachsen Chancen f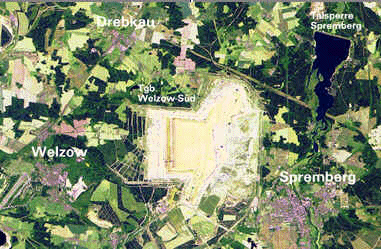 ür das
Ansiedeln von verschiedenartigen Pflanzen und Tieren, die solche
Lebensbedingungen bevorzugen und sich so neue Lebensräume
erschließen. Zum anderen können Einrichtungen unterschiedlichen
Charakters für die aktive Erholung, wie Trimm-dich-Pfade,
Badesseen, Motorsportflächen u.a. geschaffen werden. Der "Senftenberger
See" ist zum Beispiel ein Badeparadies im einstigen
Tagebau Niemtsch. Einer der bedeutenden deutschen
Landschaftsplaner Dr. Otto Rindt setzte hier seine Visionen von
einer Landschaft nach der Kohle um. Die Erfahrungen bei der
Gestaltung des Senftenberger Sees fließen hier unmittelbar in
die Planungen der Landschaftsarchitektur künftiger Bergbauseen
im Bereich der Niederlausitzer Seenlandschaft ein.
ür das
Ansiedeln von verschiedenartigen Pflanzen und Tieren, die solche
Lebensbedingungen bevorzugen und sich so neue Lebensräume
erschließen. Zum anderen können Einrichtungen unterschiedlichen
Charakters für die aktive Erholung, wie Trimm-dich-Pfade,
Badesseen, Motorsportflächen u.a. geschaffen werden. Der "Senftenberger
See" ist zum Beispiel ein Badeparadies im einstigen
Tagebau Niemtsch. Einer der bedeutenden deutschen
Landschaftsplaner Dr. Otto Rindt setzte hier seine Visionen von
einer Landschaft nach der Kohle um. Die Erfahrungen bei der
Gestaltung des Senftenberger Sees fließen hier unmittelbar in
die Planungen der Landschaftsarchitektur künftiger Bergbauseen
im Bereich der Niederlausitzer Seenlandschaft ein.
Start
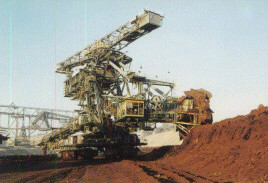 Die Fördermengen, in der Anfangszeit nur einige
hundert Tonnen, stiegen ständig und erreichten fast 200
Millionen t im Jahr 1989. Die Braunkohle war damit eine wichtige
Basis für die Entwicklung der Lausitzer Wirtschaft und des
Wohlstandes der Einwohner. Zugleich prägte der Bergbau Natur und
Umwelt im Revier. Mit der Inanspruchnahme von Flächen für die
Kohleförderung und der nachfolgenden Rekultivierung wurde das
Landschaftsbild der Lausitz entscheidend beeinflußt. Jedoch
konnte die Wiederherstellung der Landschaft nach dem Bergbau in
jedem Falle der Inanspruchnahme standhalten.
Die Fördermengen, in der Anfangszeit nur einige
hundert Tonnen, stiegen ständig und erreichten fast 200
Millionen t im Jahr 1989. Die Braunkohle war damit eine wichtige
Basis für die Entwicklung der Lausitzer Wirtschaft und des
Wohlstandes der Einwohner. Zugleich prägte der Bergbau Natur und
Umwelt im Revier. Mit der Inanspruchnahme von Flächen für die
Kohleförderung und der nachfolgenden Rekultivierung wurde das
Landschaftsbild der Lausitz entscheidend beeinflußt. Jedoch
konnte die Wiederherstellung der Landschaft nach dem Bergbau in
jedem Falle der Inanspruchnahme standhalten. 
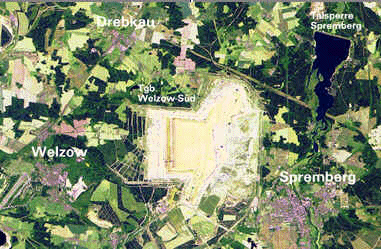 ür das
Ansiedeln von verschiedenartigen Pflanzen und Tieren, die solche
Lebensbedingungen bevorzugen und sich so neue Lebensräume
erschließen. Zum anderen können Einrichtungen unterschiedlichen
Charakters für die aktive Erholung, wie Trimm-dich-Pfade,
Badesseen, Motorsportflächen u.a. geschaffen werden. Der
ür das
Ansiedeln von verschiedenartigen Pflanzen und Tieren, die solche
Lebensbedingungen bevorzugen und sich so neue Lebensräume
erschließen. Zum anderen können Einrichtungen unterschiedlichen
Charakters für die aktive Erholung, wie Trimm-dich-Pfade,
Badesseen, Motorsportflächen u.a. geschaffen werden. Der