Kloster Sankt Marienstern
Zu den wenigen historischen Klöstern in Mitteleuropa,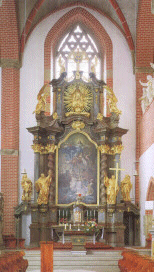 welche in ihrer vielhundertjährigen Geschichte niemals eine Auflösung
erfuhren, gehört die Zisterzienserinnen-Abtei Klosterstift St.
Marienstern in der sächsischen Oberlausitz. Ihre Lage im Städtestaat
der beiden Lausitzen, dessen frühere lehnsrechtliche Zugehörigkeit
zum Königreich Böhmen und die Übertragung der Lehnsträgerschaft
an die sächsischen Kurfürsten 1635 erklärt, daß das 1248
gestiftete Kloster die lutherische Reformation überdauerte und
von den josefinischen Reformen nicht überdauert wurde. Trotz
mehrfacher Zerstörungen so durch die Hussiten 1429 sowie durch
die Schweden 1639,
welche in ihrer vielhundertjährigen Geschichte niemals eine Auflösung
erfuhren, gehört die Zisterzienserinnen-Abtei Klosterstift St.
Marienstern in der sächsischen Oberlausitz. Ihre Lage im Städtestaat
der beiden Lausitzen, dessen frühere lehnsrechtliche Zugehörigkeit
zum Königreich Böhmen und die Übertragung der Lehnsträgerschaft
an die sächsischen Kurfürsten 1635 erklärt, daß das 1248
gestiftete Kloster die lutherische Reformation überdauerte und
von den josefinischen Reformen nicht überdauert wurde. Trotz
mehrfacher Zerstörungen so durch die Hussiten 1429 sowie durch
die Schweden 1639,  bewahrt das
Kloster noch einen reichen Kulturbesitz, dessen älteste Gegenstände
noch der frühen Klosterzeit angehören. Im Grüngürtel um das
Kloster bauten die Nonnen Obst, Kräuter, Gemüse und Hopfen an,
zeitweilig auch Tabak. Kräutertee, Klosterbalsam und Klosterbier
waren begehrte Handelsartikel. Die Mariensterner Klosterbrauerei
stellte erst 1973 ihre Arbeit ein. Das Kloster spielte im
regionalen
bewahrt das
Kloster noch einen reichen Kulturbesitz, dessen älteste Gegenstände
noch der frühen Klosterzeit angehören. Im Grüngürtel um das
Kloster bauten die Nonnen Obst, Kräuter, Gemüse und Hopfen an,
zeitweilig auch Tabak. Kräutertee, Klosterbalsam und Klosterbier
waren begehrte Handelsartikel. Die Mariensterner Klosterbrauerei
stellte erst 1973 ihre Arbeit ein. Das Kloster spielte im
regionalen  Wirtschaftsleben früher
immer eine doppelte Rolle: Es war der größte Betrieb im weiten
Umkreis und zugleich der wichtigste Abnehmer von Waren und
Dienstleistungen. Zwischen 100 und 200 Personen waren ständig zu
versorgen: Nonnen, Laienschwestern, Novizinnen, Schülerinnen,
Pensionäre, Gäste, Klosterbeamte, Diener und Hofgesinde. Dazu
kam der nicht abreißende Strom von Bedürftigen, die am Kloster
vorsprachen. Um diesen Bedarf zu decken, siedelten sich schon im
Mittelalter zahlreiche Handwerker in den Klosterdörfern an. Im
Klosterurbar von 1374 werden Müller, Schmiede, Schneider, Weber,
je ein Zimmermann, Stellmacher, Ölschläger, Schuster,
Fleischhauer, Töpfer und Brettschneider genannt. Noch heute ist
St. Marienstern der größte Arbeitgeber in Panschwitz-Kuckau.
Wirtschaftsleben früher
immer eine doppelte Rolle: Es war der größte Betrieb im weiten
Umkreis und zugleich der wichtigste Abnehmer von Waren und
Dienstleistungen. Zwischen 100 und 200 Personen waren ständig zu
versorgen: Nonnen, Laienschwestern, Novizinnen, Schülerinnen,
Pensionäre, Gäste, Klosterbeamte, Diener und Hofgesinde. Dazu
kam der nicht abreißende Strom von Bedürftigen, die am Kloster
vorsprachen. Um diesen Bedarf zu decken, siedelten sich schon im
Mittelalter zahlreiche Handwerker in den Klosterdörfern an. Im
Klosterurbar von 1374 werden Müller, Schmiede, Schneider, Weber,
je ein Zimmermann, Stellmacher, Ölschläger, Schuster,
Fleischhauer, Töpfer und Brettschneider genannt. Noch heute ist
St. Marienstern der größte Arbeitgeber in Panschwitz-Kuckau.
Start
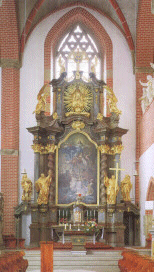 welche in ihrer vielhundertjährigen Geschichte niemals eine Auflösung
erfuhren, gehört die Zisterzienserinnen-Abtei Klosterstift St.
Marienstern in der sächsischen Oberlausitz. Ihre Lage im Städtestaat
der beiden Lausitzen, dessen frühere lehnsrechtliche Zugehörigkeit
zum Königreich Böhmen und die Übertragung der Lehnsträgerschaft
an die sächsischen Kurfürsten 1635 erklärt, daß das 1248
gestiftete Kloster die lutherische Reformation überdauerte und
von den josefinischen Reformen nicht überdauert wurde. Trotz
mehrfacher Zerstörungen so durch die Hussiten 1429 sowie durch
die Schweden 1639,
welche in ihrer vielhundertjährigen Geschichte niemals eine Auflösung
erfuhren, gehört die Zisterzienserinnen-Abtei Klosterstift St.
Marienstern in der sächsischen Oberlausitz. Ihre Lage im Städtestaat
der beiden Lausitzen, dessen frühere lehnsrechtliche Zugehörigkeit
zum Königreich Böhmen und die Übertragung der Lehnsträgerschaft
an die sächsischen Kurfürsten 1635 erklärt, daß das 1248
gestiftete Kloster die lutherische Reformation überdauerte und
von den josefinischen Reformen nicht überdauert wurde. Trotz
mehrfacher Zerstörungen so durch die Hussiten 1429 sowie durch
die Schweden 1639,  bewahrt das
Kloster noch einen reichen Kulturbesitz, dessen älteste Gegenstände
noch der frühen Klosterzeit angehören. Im Grüngürtel um das
Kloster bauten die Nonnen Obst, Kräuter, Gemüse und Hopfen an,
zeitweilig auch Tabak. Kräutertee, Klosterbalsam und Klosterbier
waren begehrte Handelsartikel. Die Mariensterner Klosterbrauerei
stellte erst 1973 ihre Arbeit ein. Das Kloster spielte im
regionalen
bewahrt das
Kloster noch einen reichen Kulturbesitz, dessen älteste Gegenstände
noch der frühen Klosterzeit angehören. Im Grüngürtel um das
Kloster bauten die Nonnen Obst, Kräuter, Gemüse und Hopfen an,
zeitweilig auch Tabak. Kräutertee, Klosterbalsam und Klosterbier
waren begehrte Handelsartikel. Die Mariensterner Klosterbrauerei
stellte erst 1973 ihre Arbeit ein. Das Kloster spielte im
regionalen  Wirtschaftsleben früher
immer eine doppelte Rolle: Es war der größte Betrieb im weiten
Umkreis und zugleich der wichtigste Abnehmer von Waren und
Dienstleistungen. Zwischen 100 und 200 Personen waren ständig zu
versorgen: Nonnen, Laienschwestern, Novizinnen, Schülerinnen,
Pensionäre, Gäste, Klosterbeamte, Diener und Hofgesinde. Dazu
kam der nicht abreißende Strom von Bedürftigen, die am Kloster
vorsprachen. Um diesen Bedarf zu decken, siedelten sich schon im
Mittelalter zahlreiche Handwerker in den Klosterdörfern an. Im
Klosterurbar von 1374 werden Müller, Schmiede, Schneider, Weber,
je ein Zimmermann, Stellmacher, Ölschläger, Schuster,
Fleischhauer, Töpfer und Brettschneider genannt. Noch heute ist
St. Marienstern der größte Arbeitgeber in Panschwitz-Kuckau.
Wirtschaftsleben früher
immer eine doppelte Rolle: Es war der größte Betrieb im weiten
Umkreis und zugleich der wichtigste Abnehmer von Waren und
Dienstleistungen. Zwischen 100 und 200 Personen waren ständig zu
versorgen: Nonnen, Laienschwestern, Novizinnen, Schülerinnen,
Pensionäre, Gäste, Klosterbeamte, Diener und Hofgesinde. Dazu
kam der nicht abreißende Strom von Bedürftigen, die am Kloster
vorsprachen. Um diesen Bedarf zu decken, siedelten sich schon im
Mittelalter zahlreiche Handwerker in den Klosterdörfern an. Im
Klosterurbar von 1374 werden Müller, Schmiede, Schneider, Weber,
je ein Zimmermann, Stellmacher, Ölschläger, Schuster,
Fleischhauer, Töpfer und Brettschneider genannt. Noch heute ist
St. Marienstern der größte Arbeitgeber in Panschwitz-Kuckau.