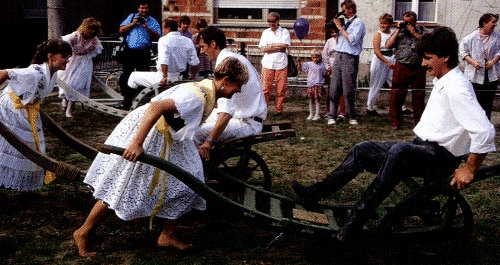Sorbische
Bräuche und Traditionen
Jährlich finden in der sorbischen Lausitz, dem größten Trachtengebiet Deutschlands, zahlreiche traditionelle Volksfeste statt. Jeder Besucher oder Tourist findet dabei Anlässe und Gelegenheiten, die Sitten und Bräuche, Lieder, Tänze, Volksinstrumente sowie Sagen und Märchen des
Slawenvolkes kennenzulernen. Dies dürfte niemandem schwer fallen, denn die geselligen und farbenfrohen Feste der gastfreundlichen Menschen verraten viel über ihre naturverbundene Lebensweise und ihr sympathisches Wesen. Die Bräuche und Trachten der katholischen Lausitz - im relativ geschlossenen Raum zwischen den Kreisstädten Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda - unterscheiden sich etwas von denen der evangelischen Sorben oder Wenden im Bereich der Ober- und Niederlausitz. Wir nennen hier nur einige allgemeingültige Bräuche, die jeden anregen sollten, die Lausitzer Sorben und Wenden selbst kennenzulernen.
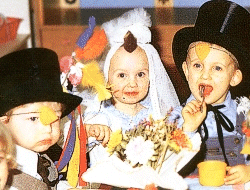 Den Anfang dieser fröhlichen Traditionen bildet die Vogelhochzeit, ein lustiger Kinderspaß. Hier werden
am Vorabend des 25. Januar leere Teller ans Fenster gestellt, auf denen die Vögel aus Dankbarkeit für die
Winterfütterung Gebäck und Süßigkeiten während ihres Hochzeitsfluges für die Kleinen ablegen. Am
folgenden Morgen schlüpfen die Kinder in bunte Vogelkostüme und verbringen den Tag bei ausgelassenem
Spiel, Tanz und Gesang.
Den Anfang dieser fröhlichen Traditionen bildet die Vogelhochzeit, ein lustiger Kinderspaß. Hier werden
am Vorabend des 25. Januar leere Teller ans Fenster gestellt, auf denen die Vögel aus Dankbarkeit für die
Winterfütterung Gebäck und Süßigkeiten während ihres Hochzeitsfluges für die Kleinen ablegen. Am
folgenden Morgen schlüpfen die Kinder in bunte Vogelkostüme und verbringen den Tag bei ausgelassenem
Spiel, Tanz und Gesang.

Einen ähnlich winterlichen Bezug hat die sich anschließende Fastnacht, im Niedersorbischen auch Zapust genannt. Ihr früherer Sinn lag einmal darin, die jahreszeitlich bedingten Zusammenkünfte in den Spinnstuben zu beenden und den Winter zu vertreiben.
Aus Freude über das Ende der langen Wartezeit zwischen eingebrachter Ernte und der neuen
Aussaat ziehen die Menschen beim Zampern durch die Straßen. Kostümiert oder in Trachten gekleidet, sammeln
die mit Kiepe, Kober und Geldbeutel ausgestatteten Zamperleute an drei Tagen Speck, Eier, Geld und Schnaps ein, wobei
musiziert, getanzt und getrunken wird. Sind sie so auf ihrem Heischegang von Hof zu Hof gezogen, findet
am dritten Tag oder am folgenden Wochenende der große Fastnachtstanz statt. Hier werden alle eingesammelten Gaben wieder aufgebraucht,
was in einem riesigen Eierkuchenessen gipfelt. Leider findet man in den heutigen
Zamperumzügen die früher so typischen Symbolfiguren des abziehenden Winters und des beginnenden Frühlings, den Erbsstrohbären, den Schimmelreiter, den Storch und die Wurstbrüder
nicht mehr.

 Hat der Winter seine Schuldigkeit getan, beginnen die zahlreichen
Frühlingsbräuche. Von diesen dürfte das Ostereiermalen der bekannteste sein. Dabei verziert man in verschiedenen Techniken Eier, die ein
Symbol der Fruchtbarkeit sind, sehr kunstvoll. Meist wird dabei die Wachsbatik angewandt, aber auch die Kratz-, Ätz- und Wachsbossiertechnik werden von vielen Volkskünstlern gepflegt.
Zur Osterzeit gibt es auf verschiedenen Ostereiermärkten die Möglichkeit, den Künstlern bei ihrer filigranen Arbeit über die
Schulter zu schauen.
Hat der Winter seine Schuldigkeit getan, beginnen die zahlreichen
Frühlingsbräuche. Von diesen dürfte das Ostereiermalen der bekannteste sein. Dabei verziert man in verschiedenen Techniken Eier, die ein
Symbol der Fruchtbarkeit sind, sehr kunstvoll. Meist wird dabei die Wachsbatik angewandt, aber auch die Kratz-, Ätz- und Wachsbossiertechnik werden von vielen Volkskünstlern gepflegt.
Zur Osterzeit gibt es auf verschiedenen Ostereiermärkten die Möglichkeit, den Künstlern bei ihrer filigranen Arbeit über die
Schulter zu schauen.
Osterreiten, Osterwasserholen und Ostersingen sind vielleicht weniger bekannte Bräuche, nehmen aber in der Tradition der
Sorben einen festen Platz ein. Zu Osterfeuern, die in der Nacht vom Ostersamstag zum Ostersonntag in vielen Ortschaften angezündet werden, zieht es nicht nur die Sorben und Wenden, sondern auch sehr viele Deutsche aus den Städten. In der Walpurgisnacht, am 30. April, wird der Winter mit dem Hexenbrennen
endgültig zum Teufel gejagt. Die jungen Burschen des Dorfes entzünden riesige Feuer, in denen die aus Lumpen
zusammengenähten Hexen verbrannt werden. Am Vorabend des ersten Mai stellen die Burschen in vielen Orten auch einen aus dem Wald gestohlenen Maibaum auf, dessen Größe und Kraft für die Gemeinde symbolischen Schutz verkörpern. Der Maibaum muß bis zum nächsten Tag bewacht werden, damit er nicht von Jugendlichen anderer Orte gestohlen oder abgesägt wird, was dem Ort Unglück bringen würde. Noch ehe bei Dorffesten zu Pfingsten der
Maibaum wieder fällt, ist er an die meistbietenden Dorfbewohner verkauft.
Der Sommer ist die Zeit ausgelassener Erntebräuche, bei denen es um Geschicklichkeit und
sportliche Erfolge geht wie zum Beispiel beim Johannisreiten, Hahnrupfen, Hahnschlagen, Froschkarren,
Stollen- und Stoppelreiten. Trachtenmädchen
überreichen den Siegern der Wettkämpfe Kränze aus Eichenlaub.
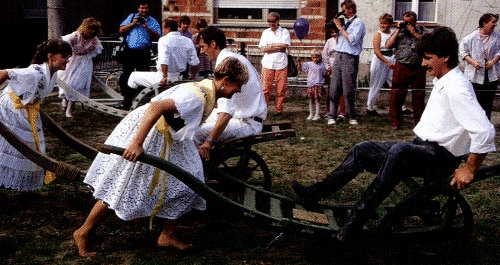
So finden das ganze Jahr über noch weitere bunte Volksfeste statt, die den
aufgeschlossenen Besuchern ein beeindruckendes Bild lebendiger Sorbentraditionen vermitteln. Dorffeste,
Trachtenumzüge, Schützenfeste oder Kirmes- und Erntedankfeste sind immer wieder Anziehungspunkte,
die Frohsinn und gute Laune, Spaß und Entspannung für die ganze Familie bieten.
Umfassende Auskünfte über die sorbische Kultur- und Lebensweise und zu Terminen oder
Veranstaltungen geben die sorbische Kulturinformation "Lodka" im Wendischen Haus in Cottbus und das sorbische Museum in Bautzen.
Start
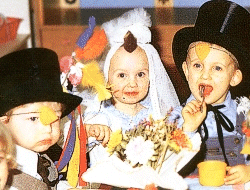 Den Anfang dieser fröhlichen Traditionen bildet die Vogelhochzeit, ein lustiger Kinderspaß. Hier werden
am Vorabend des 25. Januar leere Teller ans Fenster gestellt, auf denen die Vögel aus Dankbarkeit für die
Winterfütterung Gebäck und Süßigkeiten während ihres Hochzeitsfluges für die Kleinen ablegen. Am
folgenden Morgen schlüpfen die Kinder in bunte Vogelkostüme und verbringen den Tag bei ausgelassenem
Spiel, Tanz und Gesang.
Den Anfang dieser fröhlichen Traditionen bildet die Vogelhochzeit, ein lustiger Kinderspaß. Hier werden
am Vorabend des 25. Januar leere Teller ans Fenster gestellt, auf denen die Vögel aus Dankbarkeit für die
Winterfütterung Gebäck und Süßigkeiten während ihres Hochzeitsfluges für die Kleinen ablegen. Am
folgenden Morgen schlüpfen die Kinder in bunte Vogelkostüme und verbringen den Tag bei ausgelassenem
Spiel, Tanz und Gesang.


 Hat der Winter seine Schuldigkeit getan, beginnen die zahlreichen
Frühlingsbräuche. Von diesen dürfte das Ostereiermalen der bekannteste sein. Dabei verziert man in verschiedenen Techniken Eier, die ein
Symbol der Fruchtbarkeit sind, sehr kunstvoll. Meist wird dabei die Wachsbatik angewandt, aber auch die Kratz-, Ätz- und Wachsbossiertechnik werden von vielen Volkskünstlern gepflegt.
Zur Osterzeit gibt es auf verschiedenen Ostereiermärkten die Möglichkeit, den Künstlern bei ihrer filigranen Arbeit über die
Schulter zu schauen.
Hat der Winter seine Schuldigkeit getan, beginnen die zahlreichen
Frühlingsbräuche. Von diesen dürfte das Ostereiermalen der bekannteste sein. Dabei verziert man in verschiedenen Techniken Eier, die ein
Symbol der Fruchtbarkeit sind, sehr kunstvoll. Meist wird dabei die Wachsbatik angewandt, aber auch die Kratz-, Ätz- und Wachsbossiertechnik werden von vielen Volkskünstlern gepflegt.
Zur Osterzeit gibt es auf verschiedenen Ostereiermärkten die Möglichkeit, den Künstlern bei ihrer filigranen Arbeit über die
Schulter zu schauen.